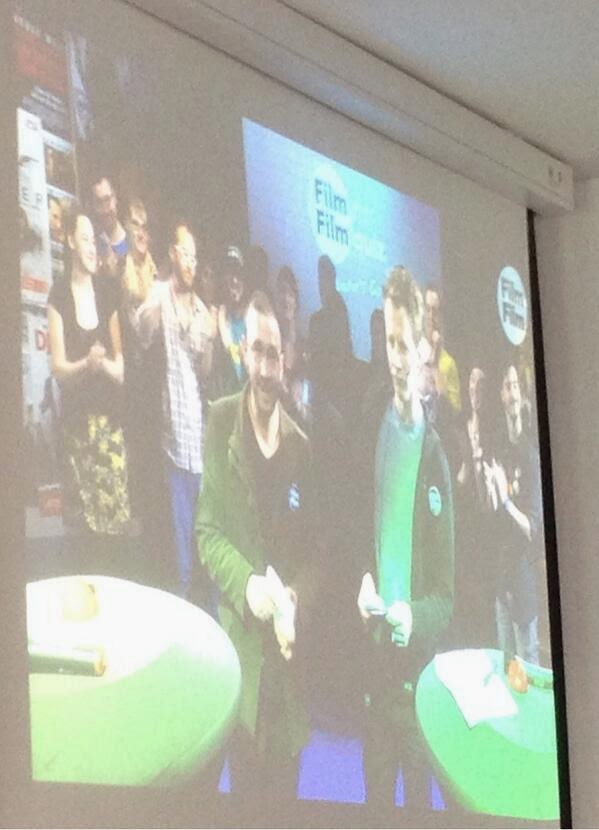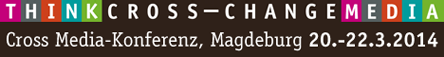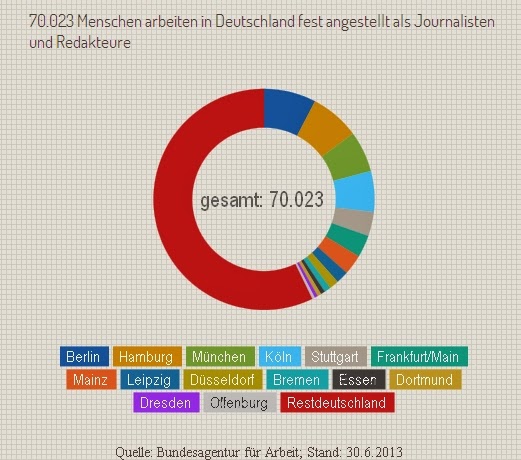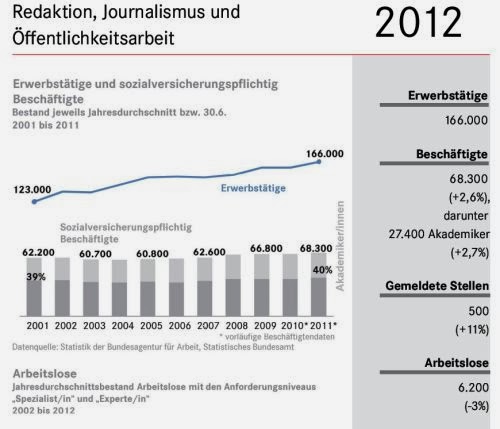Filmriss-Filmquiz Director’s Cut stößt auf großes Interesse
Für die vorlesungsfreie Zeit Ende März war viel los im Hörsaalgebäude 14 auf dem Campus-Gelände der Hochschule Magdeburg-Stendal. Vom 20.-22. März lud die Hochschule Magdeburg zur Fachkonferenz Think cross – change media (#tccm14). Auf der Crossmedia-Konferenz in Magdeburg trafen sich Lehrende und Studierende sowie Praktiker aus Medienunternehmen und Produktionsfirmen. Dass der Seminarraum 5 so überbelegt war, dass Leute teilweise auf Tischen oder dem Boden saßen, lag am Thema: Unter dem Begriff Transmedia berichtete Filmemacher Timo Simek über die Schwierigkeiten, einen Markt für ein transmediales Animations- und Gameprojekt zu finden. Henry Bauer, Exozet GmbH und Kristian Costa-Zahn, UFA Lab, zeigten, wie transmediale Produktionen entstehen. Sebastian Gomon, Ulrich Schmedes und Gabriele Hooffacker stellten die Ergebnisse des studentischen Projekts „Filmriss-Filmquiz Director’s Cut“ aus dem Wintersemester 2013/14 vor.
Screenshots und Ausschnitte aus der Quiz-Show ließen das Filmriss-Filmquiz in Magdeburg lebendig werden. Im Anschluss an die Crossmedia-Konferenz entsteht ein Tagungsband, in dem das Filmriss-Filmquiz wissenschaftlich begleitet und ausgewertet wird. Fazit von Moderator Björn Stockleben: Das sei „Studentenfernsehen, das nicht wie Studentenfernsehen aussieht“.
Gomon vertraten die HTWK Leipzig mit einem Beitrag über das Filmriss-FilmquizDirector’s Cut, das Studierende der Medientechnik im Wintersemester realisiert
haben.
Storify-Bericht zur tccm14
Präsentation zum Filmriss-Filmquiz